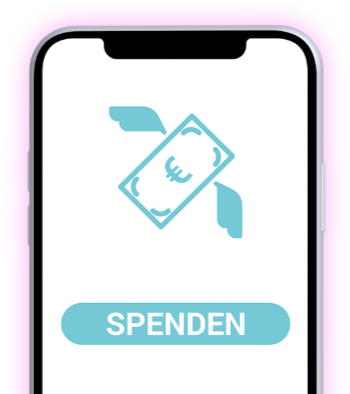Lange haben Trans*- und queere Communities dafür gekämpft, das diskriminierende Transsexuellengesetz durch ein Selbstbestimmungsgesetz abzulösen – nun hat die Bundesregierung ihren diesbezüglichen Gesetzesentwurf veröffentlicht. Der Text stellt einen Meilenstein auf dem Weg zur geschlechtlichen Selbstbestimmung dar – enthält aber Potential für weitere Diskriminierung. Als Queeres Netzwerk NRW fordern wir ein klares Bekenntnis zu geschlechtlicher und körperlicher Autonomie. Dazu gehört der Verzicht auf diskriminierende Wartezeiten und Hausrechts-Regelungen. Die Stärkung der geschlechtlichen Selbstbestimmung muss konsequent in alle Lebensbereiche übertragen werden – ohne Ausnahmeregelungen insbesondere in Gewaltschutzräumen und im Verteidigungsfall.
Lilith Raza, Vorständin im Queeren Netzwerk NRW, betont die große Bedeutung der geplanten Gesetzesänderung: „Mit dem Selbstbestimmungsgesetz wird endlich gesetzliche Realität, was wir aus Community-Arbeit und Forschung längst wissen: die Auskunft über das Geschlecht einer Person kann nur von ihr selbst kommen. Außenstehende können einer Person ihr Geschlecht weder ansehen noch diagnostizieren.“ Psycholog*innen, Berater*innen, Ärzt*innen, Freund*innen und Familie könnt auf dem Weg der geschlechtlichen Selbstfindung und bei einer Transition [1] wichtige Unterstützung leisten, so Raza. Aber sie könnten und sie sollten nicht entscheiden, welcher Personenstand, welcher Name und welches Pronomen eine andere Person am besten beschreiben. „Durch das Selbstbestimmungsgesetz wäre das menschenverachtende Transsexuellengesetz, dessen Regelungen überwiegend schon vom Bundesverfassungsgericht kassiert worden sind, endlich Geschichte. Vor allem feiern wir, dass die entwürdigende Gutachtenpflicht zur Änderung von Vornamen und Personenstand endlich abgeschafft werden soll. Das gleiche gilt für die Vorlage eines ärztlichen Attests, zu der inter* Menschen aktuell bis auf Ausnahmefälle gezwungen sind, wenn sie ihren Personenstand ändern lassen möchten.“ Positiv bewertet Raza auch, dass der Referent*innenentwurf absichtliche Fremdoutings (Verstöße gegen das Offenbarungsverbot) als eine Ordnungswidrigkeit einstuft, die mit einem Bußgeld von bis zu 10.000€ geahndet werden kann. Zusätzlich sollten nicht absichtliche fahrlässige Verstöße jedoch ebenfalls geahndet werden.
Sehr kritisch zu betrachten ist, dass einige entworfene Regelungen erneut Einschränkungen der Selbstbestimmung von trans* und inter* Menschen beinhalten und außerdem einen Fokus darauf legen, wie insbesondere cis Menschen das Gesetz ausnutzen könnten. Diese Möglichkeiten wurden in der dem Entwurf vorangegangenen öffentlichen Debatte von trans*feindlichen Akteur*innen strategisch aufgeblasen und haben nach der Veröffentlichung der Eckpunkte zum Selbstbestimmungsgesetz im Juni 2022 Eingang in den vorliegenden Entwurf gefunden. Der Zugang zu beispielsweise Frauensaunen muss selbstverständlich für alle Frauen möglich sein, unabhängig davon, ob sie cis oder trans* sind. Dringend notwendig ist außerdem ist eine trans*inklusive Reform des Abstammungsrechtes, um die rechtlichen Diskriminierungen von trans* Eltern zu beenden, die in der im Referent*innenentwurf enthaltenen Interimslösung fortbestehen. Und in Quotenregelungen, die im Referent*innenentwurf weiterhin binär gedacht werden, müssen nicht-binäre Menschen unbedingt berücksichtigt werden. Nachbesserungsbedarf besteht außerdem im Hinblick auf missverständliche Formulierungen im Entwurf, die sich zum Teil nur aus der Gesetzesbegründung erschließen lassen, so im Hinblick auf die Bereiche Gesundheit und Sport. Auch unabhängig von aktuellen rechtlichen Entwicklungen fordern wir als Queeres Netzwerk deutlich mehr Maßnahmen zum Abbau von Diskriminierungen von trans*, nicht-binären und inter* Menschen im Gesundheitssystem sowie größeren Einsatz als bisher für die Förderung der Teilhabe von trans*, nicht-binären und inter* Menschen im Sport.
Besonders große Sorge bereitet Raza, dass der Referent*innenentwurf die Möglichkeit, den Vornamen und/oder Personenstand durch eine einfache Erklärung beim Standesamt zu ändern, nur für Volljährige vorsieht. Minderjährige ab 14 Jahren benötigen demnach die Zustimmung der Sorgeberechtigten. Wenn diese nicht zustimmen, soll ein Familiengericht auf Antrag die Entscheidung treffen können. „Eine selbstbestimmte Änderung des eigenen Vornamens und Geschlechtseintrags sollte ab 14 Jahren möglich sein, entsprechend den Regelungen beispielsweise zur Religionsmündigkeit“, so Raza. „Viele junge Menschen haben keine unterstützenden Sorgeberechtigten und der Weg über das Familiengericht würde eine riesige Hürde für sie darstellen. Das Grundrecht der geschlechtlichen Selbstbestimmung muss auch für Jugendliche gelten.“ Außerdem sollte dringend geprüft werden, wie Volljährigen, für die ein*e Betreuer*in bestellt und ein Einwilligungsvorbehalt angeordnet ist, mehr Selbstbestimmung ermöglicht werden kann.
Wichtig sei jetzt, die bewährten Anlaufstellen für trans* Menschen und ihre Angehörigen zu stärken und weitere Fortbildungsangebote für Fachkräfte der sozialen Arbeit, in Standesämtern, Familiengerichten und Co. zu schaffen, so Raza. „Es ist und bleibt wichtig, dass zum Beispiel Eltern wissen, wohin sie sich wenden können, wenn ihr Kind sein zugeschriebenes Geschlecht in Frage stellt oder ihnen mitteilt, dass es trans* ist. Das gilt besonders für Eltern und Sorgeberechtigte von unter 14-Jährigen – denn nur sie können nach dem Referent*innenentwurf einen Antrag auf Änderung von Vornamen und Personenstand der Kinder stellen, nicht die Kinder selbst.“ Auch für ältere trans* Jugendliche und junge Erwachsene sei es von entscheidender Bedeutung, dass ihr engstes persönliches Umfeld Zeit und Raum habe, sich mit Trans*-Themen auseinanderzusetzen. Die katastrophalen Konsequenzen, die mangelnde Akzeptanz haben könne, zeige sich aktuell etwa in der drastisch erhöhten Suizidrate junger trans* Menschen im Vergleich zu gleichaltrigen Jugendlichen. „In der Familie und im Freund*innenkreis geliebt und angenommen zu werden, wie man ist, ist ein menschliches Grundbedürfnis. Gleichzeitig bestehen rund um das Themenfeld geschlechtliche Vielfalt oft große Unsicherheiten, unter Umständen auch Ängste und Vorurteile. Wichtig ist, dass der Prozess des Lernens und der Arbeit mit den eigenen Vorurteilen nicht zu Lasten von trans* Menschen geht.“
Raza verweist auf das Projekt „Trans*sensibel – Bezugspersonen junger trans* Menschen unterstützen“, das in NRW seit September 2021 eine vernetzende und beratende Funktion für Eltern, (Wahl-)Familie und Fachkräfte der (teil)stationären Jugendhilfe darstellt. „Solche Anlaufstellen brauchen wir in allen Bundesländern. Und natürlich brauchen wir sie nicht nur für das familiäre Umfeld und für Sorgeberechtigte, sondern für alle, die in ihrer beruflichen oder privaten Rolle trans* Menschen begleiten – sei es als Ärzt*innen, Personalverantwortliche, Lehrkräfte, Trainer*innen, und so weiter.“
Ein Bereich, in dem die trans*inklusive Weiterentwicklung von Angeboten bereits seit vielen Jahren ein Thema ist, sind Beratungs-, Schutz- und Austauschräume für Frauen und Mädchen. „Jede feministische Arbeit setzt sich ja per se kritisch mit Geschlechternormen und der Auswirkung von Geschlecht auf Gesellschaft und Individuum auseinander,“ so Laura Becker, Vorstandssprecherin des Queeren Netzwerks. „Feministische Arbeit und Trans*-Emanzipationsbewegungen haben also viele gemeinsame Anliegen und personelle Überschneidungen, genauso wie eine gemeinsame Geschichte.“ Gleichzeitig stelle die Auseinandersetzung damit, dass Geschlecht nicht nur in binären Kategorien von Frau und Mann existiert und nicht an bestimmten körperlichen Merkmalen festzumachen ist, für viele Frauen- und Mädcheneinrichtung eine Herausforderung dar. Dieser Herausforderung müsste sich feministische Arbeit stellen. Becker verwies in diesem Zusammenhang etwa auf die Broschüre „Work in Progress“, in der die Landeskoordination Trans* des Queeren Netzwerks und des Netzwerks Geschlechtliche Vielfalt Trans* NRW Praxisbeispiele und Impulse zur trans*inklusiven Weiterentwicklung von Mädchen- und Frauenräumen gesammelt hat. „Diese und viele weitere erfolgreiche Projekte zeigen: sichere und stärkende Frauen-Schutzräume brauchen keine widersinnigen und diskriminierenden Hausrechts-Regelungen. Sondern wohl überlegte Konzepte und trans*inklusive Fortbildungen für die Teams, die diese Räume gestalten,“ so Becker. „Trans*feindliche Definitionen von Feminismus erreichen nur eins: reproduzieren Sexismus und Gewalt. Dass der Referent*innenentwurf des Selbstbestimmungsgesetzes nun trotz deutlicher Kritik, etwa von Seiten der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, cis-sexisitische, möglicherweise rechtswidrige und mindestens überflüssige Hausrechtsregelungen vorsieht, ist ein Unding.“
Kritisch zu betrachten sind am jetzt vorgelegten Entwurf des Selbstbestimmungsgesetzes auch die vorgesehene Wirksamkeitsfrist von drei Monaten und die vorgesehenen Sperrfristen. „Durch diese Regelungen wird trans* Menschen im Detail weiterhin die Fähigkeit und das Recht zur geschlechtlichen Selbstbestimmung abgesprochen“, so Mika Schäfer von der Landeskoordination Trans* NRW. Hinter den Formulierungen stünde vor allem die Vorstellung, das Selbstbestimmungsgesetz könnte ausgenutzt werden, beispielsweise um Zutritt zu Frauenschutzräumen zu erhalten und dort übergriffig zu werden. Schäfer hält das für eine von trans*feindlichen Akteur*innen geschürte Idee, die keine andere Grundlage hat als ein diskriminierendes, falsches Bild von trans* Frauen. „Wer Schutzräume verletzen will, wählt nicht erst den Weg über das Standesamt. Und wer die Grenzen anderer Menschen verletzt, sollte dafür Konsequenzen erleben – unabhängig vom Geschlecht und vom Personenstand. Das Selbstbestimmungsgesetz darf nicht dazu dienen trans*feindlichen Vorstellungen auch noch gesetzliches Gewicht zu verleihen.“
Lou Martin, Landeskoordination Inter* NRW, ergänzt, dass sich die Lage für inter* Personen durch die vorgesehene Warteperiode und die Sperrfrist mit dem Gesetzesentwurf verschlechtert. § 45b aus dem Personenstandsgesetz (PStG) entfällt mit dem Selbstbestimmungsgesetz. Der Paragraph im PStG sieht zwar vor, dass inter* Personen ein ärztliches Attest vorlegen müssen, eine Warteperiode und eine Sperrfrist gab es für inter* Personen bisher allerdings nicht. „Durch das Selbstbestimmungsgesetz darf es keinesfalls zu einer Verschlechterung der Regelungslage für inter* Menschen kommen“, so Martin.
Jona Mähler von der Landeskoordination Trans* sieht in den Warte- und Sperrfristen außerdem einen Ausdruck der realitätsfernen Vorstellung, Menschen würden sich uninformiert oder unüberlegt zu einer Transition entscheiden. „Ein Coming-out als trans* oder nichtbinär ist das Ergebnis von viel Selbstreflektion und Auseinandersetzung mit dem eigenen Geschlecht.“ Wann in diesem Prozess der richtige Punkt erreicht sei, Vorname oder Personenstand zu korrigieren, wenn überhaupt, wisse jeder Mensch für sich selbst. Das könne nach drei Monaten der Fall sein oder nach zwanzig Jahren. Auch, wenn sich bei Einzelnen der Wunsch nach einer zeitnahen erneuten Änderung einstelle, sollte dies entsprechend der geschlechtlichen Selbstbestimmung möglich sein. „Sicher ist: der Prozess beginnt nicht erst mit dem Moment, in dem eine trans* Person das Standesamt betritt – es braucht darum auch keine an diesem Punkt ansetzende Warteperiode.“ Zudem zeigen Erfahrungen aus Ländern, in denen die Änderung des Personenstands bereits selbstbestimmt(er) möglich ist (Argentinien, Belgien, Dänemark, Irland, Island, Luxemburg, Malta, Norwegen, Portugal, die Schweiz, Uruguay), dass es in fast keinen Fällen dazu kam, dass Menschen ihren Geschlechtseintrag wiederholt haben ändern lassen.
Insgesamt wirft der vorliegende Entwurf viele Sorgen auf, aus dem historischen Schritt für mehr Selbstbestimmung könnte ein Deckmäntelchen für neue Formen der Fremdbestimmung werden. Lou Martin: „Bereits bei der aktuellen niedrigschwelligen Personenstandsänderung für inter* Personen mit einer ärztlich attestierten Variante der Geschlechtsentwicklung haben wir immer wieder Fälle beobachtet, in denen einzelne Standesbeamt*innen Anträge willkürlich abgelehnt haben.“ Solche am Gesetzestext vorbeigehende Diskriminierungen seien inakzeptabel und dürften jetzt nicht einfach auf eine breitere Personengruppe übertragen werden. Lilith Raza ergänzt: „Bei der Selbstbestimmung darf es keine Kompromisse und Augenwischereien geben. Nicht aus persönlicher Willkür einzelner Standesbeamt*innen und nicht im Verteidigungsfall. Solche Ausnahmeregelungen öffnen Tür und Tor dafür, eine Fremdbestimmung durch die Hintertür wieder einzuführen. Jede gesetzliche Neuregelung muss klar machen: Selbstbestimmung ist nicht verhandelbar.“
Link: BMFSFJ - Gesetz über die Selbstbestimmung in Bezug auf den Geschlechtseintrag (SBGG)
Diese Pressemitteilung zum Download:
[1] Transition beschreibt den Prozess, den ein Mensch durchläuft, wenn sie*er Schritte unternimmt, damit sich das Geschlecht, mit dem sie*er sich identifiziert, stärkerim eigenen Leben widerspiegelt. Eine Transition kann unter anderem das Aussuchen eines neuen Vornamens, Pronomens, neuen Kleidungsstils sowie Hormonbehandlungen, operative Eingriffe und/oder die offizielle Änderung des Vornamens und des Geschlechtseintrags bedeuten.