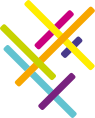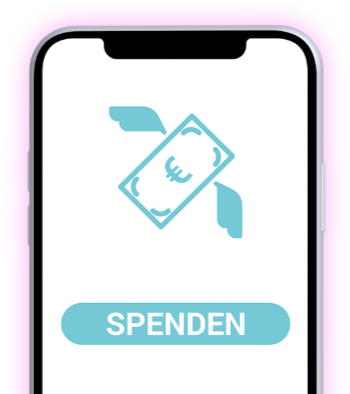Queere Jugendliche aus NRW nahmen vom 18. bis 23. Oktober 2016 an einer Gedenkstättenfahrt der Queeren Jugend NRW nach Krakau und Auschwitz teil, die von der Fachstelle Queere Jugend NRW des Schwulen Netzwerks NRW zusammen mit Jugendgruppenleitungen organisiert wurde. Cimara Witte, 20 Jahre alt, hat ihre Erfahrungen und Eindrücke in einem Bericht festgehalten. Cimara absolviert derzeit nach ihrem Abitur einen Bundesfreiwilligendienst im Internationalen Begegnungszentrum der Caritas in Wuppertal. In ihrer Freizeit beschäftigt sie sich gerne mit Geschichte und engagiert sich für die queere Jugendgruppe BJ in Wuppertal sowie für Amnesty International.
Kälte, Schmutz und Armut. Das sind wohl Dinge, die viele Menschen mit Polen verbinden, wenn sie noch nicht da gewesen sind. Freundlichkeit, Schönheit und gutes Essen. Das sind die Dinge die ich unter anderem mitgenommen habe nachdem ich zusammen mit der Fachstelle der Queeren Jugend NRW sechs Tage in Polen verbracht habe.
Dienstagvormittag ging es vom Dortmunder Flughafen los Richtung Krakau; wir waren acht Leute, welche sich vorher nur flüchtig vom Vorbereitungstreffen der Gedenkstättenfahrt im NS-Dokumentationszentrum in Köln kannten, doch auf Anhieb gut verstanden haben. Das Wetter in Krakau war wieder aller Erwartungen und Vorurteilen warm und trocken, der Flughafen groß und modern und nachdem wir dann auch alle unser Gepäck zurück hatten, stiegen wir in den Zug ein der uns zum Hauptbahnhof in die Innenstadt Krakaus brachte. Von dort aus führte uns eine sehr nette junge Frau, die uns zufällig sah, zu unserem Hostel; selbiges war einfach gehalten doch für mich vollkommen ausreichend, auch wenn der eine oder die andere Mängel zu beklagen hatte. Der Rest des Tages bestand dann daraus sich etwas einzuleben und schon mal einen ersten Eindruck von der Stadt zu gewinnen, während wir auf der Suche nach einem Abendessen waren.
Queere Jugendliche aus NRW nahmen vom 18. bis 23. Oktober 2016 an einer Gedenkstättenfahrt der Queeren Jugend NRW nach Krakau und Auschwitz teil, die von der Fachstelle Queere Jugend NRW des Schwulen Netzwerks NRW zusammen mit Jugendgruppenleitungen organisiert wurde. Cimara Witte, 20 Jahre alt, hat ihre Erfahrungen und Eindrücke in einem Bericht festgehalten. Cimara absolviert derzeit nach ihrem Abitur einen Bundesfreiwilligendienst im Internationalen Begegnungszentrum der Caritas in Wuppertal. In ihrer Freizeit beschäftigt sie sich gerne mit Geschichte und engagiert sich für die queere Jugendgruppe BJ in Wuppertal sowie für Amnesty International.
Kälte, Schmutz und Armut. Das sind wohl Dinge, die viele Menschen mit Polen verbinden, wenn sie noch nicht da gewesen sind. Freundlichkeit, Schönheit und gutes Essen. Das sind die Dinge die ich unter anderem mitgenommen habe nachdem ich zusammen mit der Fachstelle der Queeren Jugend NRW sechs Tage in Polen verbracht habe.
Dienstagvormittag ging es vom Dortmunder Flughafen los Richtung Krakau; wir waren acht Leute, welche sich vorher nur flüchtig vom Vorbereitungstreffen der Gedenkstättenfahrt im NS-Dokumentationszentrum in Köln kannten, doch auf Anhieb gut verstanden haben. Das Wetter in Krakau war wieder aller Erwartungen und Vorurteilen warm und trocken, der Flughafen groß und modern und nachdem wir dann auch alle unser Gepäck zurück hatten, stiegen wir in den Zug ein der uns zum Hauptbahnhof in die Innenstadt Krakaus brachte. Von dort aus führte uns eine sehr nette junge Frau, die uns zufällig sah, zu unserem Hostel; selbiges war einfach gehalten doch für mich vollkommen ausreichend, auch wenn der eine oder die andere Mängel zu beklagen hatte. Der Rest des Tages bestand dann daraus sich etwas einzuleben und schon mal einen ersten Eindruck von der Stadt zu gewinnen, während wir auf der Suche nach einem Abendessen waren.
Erste Spurensuche
 Am Mittwoch ging es dann bereits früh los in Richtung des Oskar-Schindler-Museums. Oskar Schindler, geboren 1908, war ein deutscher Unternehmer welcher 1939 die Emaille-Fabrik in Krakau übernahm und mit Hilfe dieser Fabrik etwa 1200 jüdischen Zwangsarbeiter*innen das Leben rettete. Bekannt wurde er vor allem durch den Film „Schindlers Liste“. Das Museum welches in besagter Fabrik entstanden ist, befasst sich hauptsächlich mit der Geschichte des Krieges in Krakau, wodurch wir viele zeitgenössische Eindrücke bekamen und mehr über den lokalen Hintergrund der Stadt lernten; nach rund zwei Stunden verließen wir das Museum wieder, mit dem Gefühl nun endgültig in Polen angekommen zu sein. Nach dem Museum hatten wir erst einmal Zeit die Stadt zu erkunden, was sich, wie ich finde, sehr gelohnt hat, da Krakau eine beeindruckende und wunderschöne Stadt ist mit liebevollen Details und historischen Gebäuden.
Am Mittwoch ging es dann bereits früh los in Richtung des Oskar-Schindler-Museums. Oskar Schindler, geboren 1908, war ein deutscher Unternehmer welcher 1939 die Emaille-Fabrik in Krakau übernahm und mit Hilfe dieser Fabrik etwa 1200 jüdischen Zwangsarbeiter*innen das Leben rettete. Bekannt wurde er vor allem durch den Film „Schindlers Liste“. Das Museum welches in besagter Fabrik entstanden ist, befasst sich hauptsächlich mit der Geschichte des Krieges in Krakau, wodurch wir viele zeitgenössische Eindrücke bekamen und mehr über den lokalen Hintergrund der Stadt lernten; nach rund zwei Stunden verließen wir das Museum wieder, mit dem Gefühl nun endgültig in Polen angekommen zu sein. Nach dem Museum hatten wir erst einmal Zeit die Stadt zu erkunden, was sich, wie ich finde, sehr gelohnt hat, da Krakau eine beeindruckende und wunderschöne Stadt ist mit liebevollen Details und historischen Gebäuden.
Queeres Polen
Am Abend stand dann das Treffen mit der queeren Aktivist*innengruppe, „Queerowy Maj“, an. Die Mitglieder*innen der Gruppe berichteten von den gesellschaftlichen und rechtlichen Bedingungen in Polen zum Thema LSBT* und stellte ihre Projekte vor; so wird seit 2009, jedes Jahr ein Festival im Kampf für Gleichberechtigung veranstaltet, welches aktuelle politische Themen anspricht, Workshops und Diskussionen anbietet und seinen Höhepunkt im Marsch der Gleichheit findet. Es war eine sehr beeindruckende Erfahrung, diese jungen Menschen kennen zulernen und von ihnen aus erster Hand zu hören, wie kritisch die Lage in manchen Bereichen zum Thema Menschenrechtsarbeit in Polen tatsächlich ist und ich bin der Überzeugung, dass sie bei ihrem Kampf für Gleichberechtigung und Akzeptanz unterstützt werden sollten. Auch wir haben unsere Projekte und Gruppen vorgestellt und einen regen Austausch mit den Krakauer Aktivist*innen geführt. Auch sie fanden es sehr interessant zu hören, wie die Lage in Deutschland ist und wie viel wir über die letzten Jahre auf die Beine stellen konnten. Magda, eine der Mitglieder*innen, teilte uns mit, dass sie Hoffnung aus unseren Berichten schöpft und glaubt, dass sie in Polen einmal etwas Ähnliches erreichen können. Diesen spannenden Abend ließen wir zusammen – also die polnischen Aktivist*innen und wir - in einer urigen Pizzeria im Kazimierz ausklingen.
Am Donnerstag begann morgens früh schon unsere Führung im „Galicia Jewish Museum“. Auch dieses Museum hinterließ einen bleibenden Eindruck, da es sich hauptsächlich um eine Bilderausstellung handelt, welche die historischen Orte jüdischen Lebens zur heutigen Zeit zeigt. Auch hier lernten wir viel über die jüdische Geschichte in Polen und vor allem Krakau selber und nahmen das Ausmaß des Genozids im slawischen Raum nun vollends war. Im Anschluss an das Museum erkundeten wir das jüdische Viertel in Krakau und besuchten eine kleine Synagoge mitsamt jüdischem Friedhof.
Nach diesem, bis dahin sehr ereignisreichem, Tag hatte wir erneut etwas Freizeit, nur leider hatte uns das gute Wetter bereits am Morgen verlassen, weswegen die meisten Zuflucht drinnen suchten anstatt noch einmal durch die Stadt zu schlendern. Am Nachmittag versammelten wir uns dann alle auf einem der Zimmer um eine gemeinsame Arbeitsphase einzulegen und uns über das bisher Gesehene auszutauschen. Wie sich herausstellte, teilten wir viele unserer Wahrnehmungen und Eindrücke. Am letzten Abend gingen wir dann nochmal in ein sehr traditionelles Restaurant und im Anschluss noch in eine Bar. Insgesamt kann ich diese drei Tage als sehr interessant, lehrreich aber auch unterhaltsam bewerten und wir alle verspürten einen leichten Stich bei dem Gedanken am nächsten Tag schon wieder weiter ziehen zu müssen.
tatsächlich ist und ich bin der Überzeugung, dass sie bei ihrem Kampf für Gleichberechtigung und Akzeptanz unterstützt werden sollten. Auch wir haben unsere Projekte und Gruppen vorgestellt und einen regen Austausch mit den Krakauer Aktivist*innen geführt. Auch sie fanden es sehr interessant zu hören, wie die Lage in Deutschland ist und wie viel wir über die letzten Jahre auf die Beine stellen konnten. Magda, eine der Mitglieder*innen, teilte uns mit, dass sie Hoffnung aus unseren Berichten schöpft und glaubt, dass sie in Polen einmal etwas Ähnliches erreichen können. Diesen spannenden Abend ließen wir zusammen – also die polnischen Aktivist*innen und wir - in einer urigen Pizzeria im Kazimierz ausklingen.
Am Donnerstag begann morgens früh schon unsere Führung im „Galicia Jewish Museum“. Auch dieses Museum hinterließ einen bleibenden Eindruck, da es sich hauptsächlich um eine Bilderausstellung handelt, welche die historischen Orte jüdischen Lebens zur heutigen Zeit zeigt. Auch hier lernten wir viel über die jüdische Geschichte in Polen und vor allem Krakau selber und nahmen das Ausmaß des Genozids im slawischen Raum nun vollends war. Im Anschluss an das Museum erkundeten wir das jüdische Viertel in Krakau und besuchten eine kleine Synagoge mitsamt jüdischem Friedhof.
Nach diesem, bis dahin sehr ereignisreichem, Tag hatte wir erneut etwas Freizeit, nur leider hatte uns das gute Wetter bereits am Morgen verlassen, weswegen die meisten Zuflucht drinnen suchten anstatt noch einmal durch die Stadt zu schlendern. Am Nachmittag versammelten wir uns dann alle auf einem der Zimmer um eine gemeinsame Arbeitsphase einzulegen und uns über das bisher Gesehene auszutauschen. Wie sich herausstellte, teilten wir viele unserer Wahrnehmungen und Eindrücke. Am letzten Abend gingen wir dann nochmal in ein sehr traditionelles Restaurant und im Anschluss noch in eine Bar. Insgesamt kann ich diese drei Tage als sehr interessant, lehrreich aber auch unterhaltsam bewerten und wir alle verspürten einen leichten Stich bei dem Gedanken am nächsten Tag schon wieder weiter ziehen zu müssen.
Im Zentrum des Nazi-Terrors
Oświęcim ist der polnische Name der Ortschaft, welche unter dem Synonym Auschwitz in die Geschichtsbücher eingegangen ist; heute leben dort rund 23 000 Menschen und sie alle trennen strickt zwischen diesen beiden Namen. Wir kamen in der Internationalen Jugendbegegnungsstätte von Oświęcim/Auschwitz unter, welche schon seit vielen Jahren darauf spezialisiert ist Schüler*innen sowie Studierenden und anderen jungen Menschen die Geschichte um die Konzentrationslager nahe zubringen. Freitagnachmittag stiegen wir dann auch schon in den Bus ein, welcher uns zum Stammlager bringen sollte. Das Wetter war schlecht und unterstrich die ohnehin bedrückte Stimmung, welche über dem ganzen Gelände schwebt wie unsichtbare Nebelschwaden. Das Eingangstor mit der zynischen Aufschrift „Arbeit macht frei“ brachte schon mal einen Vorgeschmack auf die folgenden vier Stunden in denen wir durch das Lager geführt wurden. Es ist beeindruckend und beängstigend zugleich, durch die alten Gebäude zu gehen, sich die Zellen anzuschauen und zu wissen, dass vor 75 Jahren tausende von Menschen an eben diesem Ort gelitten haben und gestorben sind. Es ist kaum in Worte zu fassen, welche Gefühle mich überkamen, als wir die Haare sahen, welche den Häftlingen abgeschoren wurden, Schuhe und Schmuck, von ihren Eigentümern entwendet und zu Bergen aufgetürmt. Töpfe, Kämme, Bilder, Erinnerungen, entfremdet und entwertet, zu Kriegszwecken missbraucht. Am meisten trafen mich jedoch die Aussagen der Überlebenden und die gefundenen Kinderzeichnungen in den Baracken, welche in einer Sonderausstellung gezeigt wurden. Zurück in der Begegnungsstätte trafen wir uns dann abends zur Nachbereitung des Gesehenen. Kira und Jan hatten verschiedene Methoden vorbereitet um uns zum Nachdenken zu bringen über das Geschehene aber auch über das, was aktuell vorgeht, da Rassismus, Vorurteile und Hass keine Phänomene des Nationalsozialismus sind, sondern sich durch die Geschichte ziehen wie ein roter Faden welcher nicht zu reißen scheint. Am Samstag, dem letzten vollen Tag für uns in Polen, fuhren wir nach Auschwitz Birkenau, welches 20 Mal größer ist als das Stammlager und weniger gut erhalten. Mein erster Gedanke, als ich das 40 km² große Gelände sah, war, dass ich auf einem riesigen Friedhof stehe der keine Grabsteine trägt. Mein zweiter Gedanke, dass das Gelände auf eine makabere Weise sehr friedvoll wirkt. Die meisten der Baracken wurden 1945, kurz vor dem Einmarsch der Roten Armee durch die Deutschen selber zerstört um Beweise zu vernichten. Die Baracken, die noch stehen, geben einen ungefähren Einblick in das, was die Menschen dort zu erleiden hatten. Die Vergasung war nur ein kleiner Teil der Vernichtungsmaschinerie der Nationalsozialisten: Tod durch Arbeit, Krankheit und Hunger zählten zu den häufigsten Gründen aus denen die Menschen gestorben sind. Es war eine harte aber lohnenswerte Erfahrung, das Lager selber zu sehen, sich die schieren Ausmaße bewusst zu machen und den Opfern zu gedenken, denn nur so kann nicht vergessen werden was passiert ist. Nur so kann verhindert werden, dass sich die Geschichte wiederholt.
Am Samstag, dem letzten vollen Tag für uns in Polen, fuhren wir nach Auschwitz Birkenau, welches 20 Mal größer ist als das Stammlager und weniger gut erhalten. Mein erster Gedanke, als ich das 40 km² große Gelände sah, war, dass ich auf einem riesigen Friedhof stehe der keine Grabsteine trägt. Mein zweiter Gedanke, dass das Gelände auf eine makabere Weise sehr friedvoll wirkt. Die meisten der Baracken wurden 1945, kurz vor dem Einmarsch der Roten Armee durch die Deutschen selber zerstört um Beweise zu vernichten. Die Baracken, die noch stehen, geben einen ungefähren Einblick in das, was die Menschen dort zu erleiden hatten. Die Vergasung war nur ein kleiner Teil der Vernichtungsmaschinerie der Nationalsozialisten: Tod durch Arbeit, Krankheit und Hunger zählten zu den häufigsten Gründen aus denen die Menschen gestorben sind. Es war eine harte aber lohnenswerte Erfahrung, das Lager selber zu sehen, sich die schieren Ausmaße bewusst zu machen und den Opfern zu gedenken, denn nur so kann nicht vergessen werden was passiert ist. Nur so kann verhindert werden, dass sich die Geschichte wiederholt.